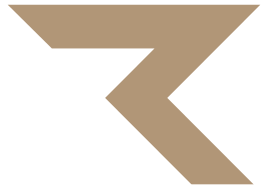Holz Mooreiche
Geschichte
"Die Faszination um die Mooreiche reicht vielfach über Jahrtausende zurück und offenbart eine einzigartige Geschichte, die durch die Konservierung in Moor- oder Sumpfgebieten über lange Zeiträume entstanden ist.
Uralte Bäume versinken in diesen Gebieten und werden durch das saure Wasser, niedrige Temperaturen und den Mangel an Sauerstoff vor dem Zersetzungsprozess bewahrt. Infolgedessen werden Eichen und andere Baumarten allmählich von den natürlichen Konservierungseigenschaften des Moores umhüllt, manchmal sogar komplett konserviert.
Diese antiken Hölzer bergen ein bemerkenswertes Potenzial als historische Informationsquelle. Sie ermöglichen Einblicke in vergangene Klimabedingungen, indem sie durch Jahresringe Informationen über das Klima und das Wachstum des Baumes während seiner Lebenszeit preisgeben. Es kommt sogar vor, dass Mooreichen Hinweise auf menschliche Aktivitäten wie Werkzeuge oder andere Artefakte in ihrer Nähe offenbaren.
Viele Mooreichen wurden während archäologischer Ausgrabungen entdeckt und trugen maßgeblich zu bedeutenden wissenschaftlichen Erkenntnissen bei. Ein prominentes Beispiel ist die Tollund-Moorleiche, ein gut erhaltener Leichnam aus dem prähistorischen Dänemark, der angeblich im 4. Jahrhundert v. Chr. lebte. Solche Entdeckungen haben Forschern und Archäologen geholfen, die Geschichte vergangener Kulturen und ihre Lebensweise zu rekonstruieren.
Mooreichen repräsentieren somit nicht bloß alte Bäume, sondern bedeutsame historische und wissenschaftliche Artefakte, die dazu beitragen, unser Verständnis vergangener Zeiten zu vertiefen."
Beschreibung
"Mooreichen sind Holzstämme, die häufig bei Entwässerungsprojekten in Mooren oder bei Maßnahmen zur Entwicklung und Besiedlung von Moorlandschaften entdeckt werden. Diese Hölzer gelten als subfossil, stammen von Eichenbäumen (Quercus spp.) und haben im Laufe der Zeit eine spezielle Eigenschaft entwickelt: Die im Holz enthaltene Gerbsäure reagiert mit den Eisensalzen im Moorwasser, wodurch das Holz verfärbt und verfestigt wird.
Die Verfärbungen weisen eine breite Palette von Farbtönen auf, darunter hellgrau, dunkelgelb, dunkelbraun, blaugrau und sogar tiefes Schwarz, wobei sie sich sehr unregelmäßig über das Holz verteilen. Diese Mooreichen werden in der Regel in Form von Stämmen mit einer Länge von 3 bis 20 Metern und einem Durchmesser von bis zu 1,3 Metern gefunden. Die Altersspanne dieser subfossilen Eichenstämme erstreckt sich von 600 Jahren bis hin zu erstaunlichen 8.500 Jahren.
Entstehung
"Subfossiles Eichenholz entsteht durch eine langfristige Lagerung von frischem Eichenholz in moorigen oder sumpfigen Gebieten unter Ausschluss von Sauerstoff. Dieser Prozess der Veränderung ist langsam und langwierig, da die gerbsäurehaltigen Holzbestandteile mit eisenreichen feuchten Böden, Wasser und ammoniakalischen Gasen in der Umgebung reagieren. Die spezifischen Lagerbedingungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Intensität der Farbänderung und anderen Veränderungen der Holzeigenschaften.
Während der langen Lagerung ist der chemische Abbau im Allgemeinen gering und betrifft hauptsächlich die Polysaccharide des Holzes. Unter dem Elektronenmikroskop zeigt sich eine erhöhte Elektronenabsorption in der Zellwand, was auf einen Anstieg des hydrolysebeständigen Anteils Hinweist. Ein geringer Zellwandabbau ist hauptsächlich am Rand der Zellhohlräume zu beobachten."
Verarbeitung
"Subfossiles Eichenholz wird in der Regel eher zufällig entdeckt. Es wird oft auf einfache Weise aus dem Boden geholt und anschließend zum Verkauf angeboten. Die Bearbeitung mit mechanischen Methoden gestaltet sich in der Regel gut, erfordert jedoch Beachtung möglicher Holzfehler wie Drehwuchs, Krümmungen, Unrundheit, Kernfäule, Hohlstämmigkeit, Rindenablösung, unverkennbare Zonen oder ungleichmäßige Jahrringbreiten, die bei der Planung des Schnittbildes berücksichtigt werden sollten.
Die nachfolgende Trocknung sollte äußerst schonend und langsam erfolgen, um die Bildung von Rissen zu vermeiden.
Subfossiles Eichenholz eignet sich gut für Verleimungen und kann problemlos mit gängigen Klebstoffen bearbeitet werden. Auch die Oberflächenbehandlung gestaltet sich gut, und das Holz lässt sich gut lackieren.
Es kann gut gesägt, gehobelt, gefräst, gebohrt, geschliffen, gedrechselt oder zu Furnieren verarbeitet werden. Gängige Verarbeitungsmethoden umfassen Halbierung, Vierteilung, vertikales und mehrfaches Schneiden. In vielen Fällen wird subfossiles Eichenholz nach der Bearbeitung noch zu Furnierholz weiterverarbeitet, insbesondere als Messerholz für Deckfurniere in Möbeln, Vertäfelungen, Parkett oder als spezielles Holz für Drechselarbeiten. Dabei wird das Holz zu etwa 95 % genutzt.
Holzqualität und Eigenschaften
Die Eigenschaften von subfossiler Eiche weichen im Wesentlichen nicht signifikant von denen rezenter Eiche ab. Nach DIN 52182 beträgt die durchschnittliche Darrdichte des subfossilen Eichenholzes etwa 0,58 bis 0,73 g/cm³, während die Rohdichte im Schnitt bei etwa 0,62 bis 0,76 g/cm³ liegt. Ähnlich wie bei rezenter Eiche ist auch das subfossile Eichenholz nur mäßig schwindend.
Die spezifischen Holzeigenschaften wie Härte, Gewicht und Bearbeitbarkeit variieren je nach Fundort und Alter des jeweiligen Holzstücks.
Die mechanische Bearbeitung gestaltet sich im Allgemeinen gut, jedoch ist Vorsicht beim Verschrauben geboten, da Vorbohrungen für Schrauben empfohlen werden, um Risse zu vermeiden.
Um Rissbildung zu verhindern, ist ein langsames und schonendes Trocknen erforderlich. Hinsichtlich der Haltbarkeit ist zu beachten, dass subfossiles Eichenholz nicht witterungsbeständig ist und nur eine mäßige Resistenz gegen Pilz- oder Insektenbefall aufweist.
Im Vergleich dazu weist rezente Eiche nach DIN 52182 eine durchschnittliche Darrdichte von etwa 0,48 bis 0,87 g/cm³ auf, wobei die Rohdichte im Durchschnitt bei etwa 0,55 bis 0,98 g/cm³ liegt. Auch rezentes Eichenholz zeigt nur mäßiges Schwindverhalten.
Die Holzeigenschaften wie Härte, Gewicht und Bearbeitbarkeit variieren je nach Einschlagort und Alter des Holzes. Rezentes Eichenholz ist im Allgemeinen gut bearbeitbar, leicht schälbar und spaltbar, jedoch aufgrund seiner Grobfasrigkeit schwieriger zu hobeln. Vorbohrungen sind auch hier beim Verschrauben von dünnem Holz empfehlenswert, um Risse zu vermeiden.
Wie beim subfossilen Eichenholz ist auch bei rezenter Eiche ein langsames und schonendes Trocknen wichtig, da beide Holzarten zum Reißen und Verziehen neigen.
Für das subfossile Eichenholz werden nach Wagenführ (2007) folgende Kennwerte für Eiche (Quercus robur L.) genannt.
FAQ Mooreiche
-
1. Welche Farbe kann Mooreiche annehmen?
In Sümpfen bzw. Mooren reagieren die im Holz enthaltenen Gerbsäuren mit den im Wasser enthaltenen Eisensalzen, wodurch sich das Holz stark verfärben kann. Die Verfärbung hängt von der Verweildauer im Moor ab. Junges Holz ist hellgrau bis dunkelbraun, altes Holz tiefschwarz.
-
2. Wo findet man Mooreichen?
Wie der Name schon sagt – sind Mooreichen keine eigene Holzart, sondern alte Eichenstämme, welche teilweise Jahrhunderte oder Jahrtausende in Mooren oder Sümpfen unter Sauerstoffabschluss vergraben waren. Diese werden meist eher per Zufall bei Bauarbeiten wie dem Aushub von Baugruben oder im Rahmen von Kiesabbau entdeckt & beinhalten meist aufwendige Bergungsarbeiten. Das erklärt die Rarität und die höheren Preise der Mooreiche.
-
3. Was ist das Besondere an Mooreichen Holz?
Mooreiche ist aufgrund Ihrer Natur & Entstehung schon sehr besonders. Neben dem Alter (2000-1000 Jahre) ist das Holz durch die lange Verweildauer in Mooren & Sümpfen extrem hart. Zusätzlich ist die dunkle Färbung, je nach alter, eine sehr ausgefallene Besonderheit für das Holz.
-
4. Wie groß wird eine Mooreiche?
Nachdem die Mooreiche nicht so wächst wie sie ist, sondern vergraben ist & gefunden wird, werden meistens nur Stämme gefunden. Diese Mooreiche Stämme werden meistens in 3 bis 20 Meter Länge gefunden – der Durchmesser kann je nach Fund bis zu 1,5 m erreichen. Das hängt oft mit dem Alter der subfossilen Stämme zusammen, die von 600 – 8500 Jahren alt sein können.
-
5. Wie erkennt man Mooreiche?
Durch die besondere „Lagerung“ in Sümpfen und Mooren, reagieren die Gerbsäuren des Holzes mit den Sumpfgasen was zur Starken Verfärbung des Holzes führt. Die Moore erkennt man am ehesten an der blau- grüngrauen bis tiefschwarzen Färbung, sowie an der extrem Härte.